Meist sind es immer die gleichen Fehler, die Prüfungsteilnehmer:innen in der Ausbildereignungsprüfung machen und die dann zu einem Nichtbestehen der Prüfung führen. Damit Ihnen das nicht auch passiert und Sie Ihre Ausbildereignungsprüfung erfolgreich bestehen, verraten wir Ihnen in dieser Artikel-Serie die 9 häufigsten Fehler, die Sie in der AEVO-Prüfung den Erfolg kosten können.
Sechster Fehler in der Ausbildereignungsprüfung: Sie führen keine Lernerfolgskontrolle durch
Ein weiterer häufiger Fehler in der Ausbildereignungsprüfung, ist eine fehlende oder falsch verwendete Lernerfolgskontrolle. Grundsätzlich gilt: Lernerfolgskontrollen sind keine Funktionskontrollen.
Wenn Sie zum Beispiel am Ende einer Ausbildungseinheit das Ergebnis von Auszubildenden anschauen und dabei feststellen, dass das Ergebnis der Auszubildenden genauso aussieht wie das, das Sie vorgemacht haben, dann ist dies lediglich eine Funktionskontrolle und keine Lernerfolgskontrolle. Sie wissen nämlich damit nicht, ob die Lerninhalte auch verstanden wurden. Wenn Sie also in Ihrer Ausbildereignungsprüfung nach der durchgeführten Lernerfolgskontrolle gefragt werden und sagen: „Ich habe das Ergebnis kontrolliert und es gleicht meinem.“ dann ist das nicht korrekt.
Die dritte Stufe der Vier-Stufen-Methode ist keine Lernerfolgskontrolle
Die dritte Stufe der Vier-Stufen-Methode ist ebenfalls keine Lernerfolgskontrolle, denn Sie haben als Ausbilder:in hier jederzeit die Möglichkeit einzugreifen und die Auszubildenden zu unterstützen, sollten sie Fehler machen oder nicht mehr weiterwissen. Auch wenn Auszubildende die Handgriffe einmalig selbstständig und richtig nachgemacht haben, ist es noch immer keine Lernerfolgskontrolle.
Auszubildende sollen mit fortschreitender Ausbildungsdauer immer mehr in der Lage sein, die Arbeitsergebnisse selbst zu kontrollieren. Darum ist es wichtig, ihnen die Möglichkeit zu geben, das Arbeitsergebnis zuerst selbst zu reflektieren, bevor Sie Ihre Einschätzung dazu geben. Auszubildende sollen lernen, selbstständig festzustellen, was sie richtig gemacht haben und an welchen Stellen die noch Verbesserungspotenzial aufweisen. Wenn Sie als ausbildende Person das Arbeitsergebnis umgehend aus Ihrer Sicht bewerten, nehmen Sie den Auszubildenden die Möglichkeit, die Fähigkeit zur Reflexion der Handlungen zu entwickeln.
Lassen Sie Auszubildene die Leistungen zunächst selbst einschätzen
Lassen Sie in der Ausbildereignungsprüfung die Auszubildenden zunächst ihr Handeln selbst einschätzen und kontrollieren. Danach kommentieren Sie das Endergebnis. Wenn Sie die Auszubildenden für ihre Leistungen loben möchten, achten Sie auch darauf, das positive Verhalten ganz konkret zu benennen. Zeigen Sie auf, was gut war. Wenn es Verbesserungspotenzial gibt, können Sie erklären, was das nächste Mal anders gemacht werden kann. Lassen Sie die Auszubildenden ganz genau wissen, was Ihnen gut gefallen hat und was Ihnen nicht so gut gefallen hat.
Wenn Auszubildende mit dem Thema oder den Abläufen einer Ausbildungseinheit nicht gut zurechtkommen und immer wieder Fehler machen, achten Sie sowohl in Ihrer Ausbildereignungsprüfung als auch in der Ausbildungs-Praxis darauf, dass es an dieser Stelle nicht angemessen ist zu loben. Die Einschätzung der Leistungen der Auszubildenden, sollen den erbrachten Leistungen entsprechen.
Erst nach der Lernerfolgskontrolle beginnt das Üben
Beauftragen Sie Auszubildende erst nach der Lernerfolgskontrolle mit dem selbstständigen Üben. Das Üben ist eine Erfolgssicherung keine Lernerfolgskontrolle. Eine Kontrolle ist immer der Übungsphase vorgelagert.
 In Ihrer Ausbildereignungsprüfung müssen Sie zunächst einmal sicherstellen, dass Auszubildende das Wissen der vorausgegangenen Ausbildungseinheit, wirklich anwenden können.
In Ihrer Ausbildereignungsprüfung müssen Sie zunächst einmal sicherstellen, dass Auszubildende das Wissen der vorausgegangenen Ausbildungseinheit, wirklich anwenden können.
Die geschlossene Frage: „Hast du alles verstanden?“ ist dafür wenig geeignet, denn Auszubildende werden diese Frage wahrscheinlich einfach mit einem kurzen „ja“ beantworten. Natürlich kann es sein, dass Auszubildende die Lerninhalte tatsächlich verstanden haben. Es kann jedoch auch sein, dass sie nicht zugeben möchten, wenn das nicht der Fall ist. Mit einem kurzen „ja“ als Antwort können Sie das nicht überprüfen. Hinterfragen Sie also auch an dieser Stelle mit ein paar weiteren Kontrollfragen, was genau verstanden wurde.
Das selbstständige Üben dient der Erfolgssicherung. Auszubildende sollen Routine in der Durchführung einer Arbeitshandlung bekommen und die dafür erforderlichen Handgriffe mit der Zeit automatisch anwenden können. Wenn Sie Auszubildende ohne Lernerfolgskontrolle direkt zum Üben schicken, laufen sie in der Übungsphase Gefahr, sich Fehler in der Ausführung anzugewöhnen.
Üben kann somit erst erfolgen, wenn zuvor eine Kontrolle stattgefunden hat. Wichtig für Sie ist, den Übungsauftrag konkret zu formulieren. In der Ausbildereignungsprüfung, ist das ein Fehler der häufig gemacht wird. Auszubildende werden fälschlicherweise lediglich aufgefordert an den Arbeitsplatz zurückzukehren und selbstständig zu üben. Was allerdings dabei fehlt, ist eine konkrete Anweisung, wie viele der Arbeitsschritte Auszubildende ausführen sollen, wie lange geübt werden soll und es fehlt die Information, ob das Ergebnis der Übung kontrolliert wird (und wenn ja, wer die Kontrolle durchführt).
Schaffen Sie Verbindlichkeit durch klare Anweisungen
Eine verbindliche Anweisung zum Üben wäre: „Jetzt kannst du zurück an deinen Arbeitsplatz, ich habe dir bereits zehn weitere Übungsaufgaben auf den Schreibtisch gelegt. Du hast eine Stunde Zeit. Danach kommst du bitte zu mir zurück und zeigst mir das Ergebnis. Falls du zwischenzeitlich Fragen hast, kannst du mich natürlich immer gerne ansprechen.“.
Somit wissen Auszubildende ganz genau,
- wie viele Aufgaben erledigt werden müssen
- wieviel Zeit für die Ausführung zur Verfügung steht
- was getan werden soll, wenn die Übung beendet ist
- dass das Ergebnis von Ihnen kontrolliert wird.
Hierdurch bekommen Auszubildende die Möglichkeit, ihr Zeitmanagement zu trainieren. Sie lernen einzuschätzen, wie lange sie für die Ausführung einer Arbeitsaufgabe brauchen und ob die Tätigkeit in der vorgegebenen Zeit zu erreichen ist.
Achten Sie also in Ihrer praktischen Ausbildereignungsprüfung darauf, dass Sie eine sinnvolle Lernerfolgskontrolle in Ihrem Planungskonzept integrieren und ebenfalls eine Übungsphase einplanen.
Siebter Fehler in der Ausbildereignungsprüfung: Sie setzen das Lehrgespräch falsch ein
In der Ausbildereignungsprüfung ist das Lehrgespräch eine oft gewählte Ausbildungsmethode. Das Lehrgespräch basiert in seiner Durchführung auf einer Gesprächsform, bei der Sie als Ausbilder:in, anknüpfend an bereits vorhandene Vorkenntnisse, den Inhalt der Ausbildungseinheit durch zielgerichtete Fragen und Impulse entwickeln und so das gewünschte Ergebnis erreichen. Die Impulse müssen nicht immer in Form von Fragen erfolgen. Sie können zum Beispiel auch Bilder oder Grafiken einsetzen, um Auszubildende anzuregen, einen Fall zu durchdenken.
Beim Lehrgespräch baut die nächste Frage auf der gegebenen Antwort auf
Das Lehrgespräch ist als Ausbildungsmethode ausbilderzentriert, da Ausbilder:innen durch ihre Fragen die Auszubildenden und den Lernprozess steuern. Zugleich lässt das Lehrgespräch den Auszubildenden in der Beantwortung einige Freiräume. Ausbilder:innen bauen beim Lehrgespräch die jeweils nächste Frage auf die von Auszubildenden gegebene Antwort auf. Deshalb wird das Lehrgespräch auch als fragend-entwickelnde Ausbildungsmethode bezeichnet. Es spricht überwiegend den kognitiven Lernzielbereich an. Das Lehrgespräch kann sowohl mit einer Person, als auch mit mehreren Auszubildenden durchgeführt werden.
Bei der Planung und Anwendung des Lehrgesprächs, werden in der praktischen Ausbildereignungsprüfung oft einige Fehler gemacht.
Viele Prüfungsteilnehmer:innen verfallen in einen „Vortragsmodus“. Sie lassen die Auszubildenden die Inhalte nicht selbstständig erarbeiten, sondern erklären diese. Das ist jedoch nicht die Zielsetzung des Lehrgesprächs und nicht der Sinn der Ausbildereignungsprüfung, sondern kann zum Nichtbestehen der Prüfung führen. Vielmehr sollen Sie als Ausbilder:in Ihre Auszubildenden durch gezielte Fragen dazu bringen, die Inhalte zu erklären.
Die Redeanteile während des Lehrgesprächs sollten mindestens 50 % bei Auszubildenden und 50 % bei Ausbilder:innen liegen. Sinnvoll ist sogar, wenn die Redeanteile von Auszubildenden wesentlich höher als die Redeanteile ausbildender Personen sind. Der Redeanteil ist demnach ein guter Indikator um festzustellen, ob Sie noch in einem fragend-entwickelnden Lehrgespräch sind oder ob Sie bereits in den Vortragsmodus verfallen sind.
Die Fragetechnik als Erfolgsfaktor
Ein ganz entscheidender Faktor, der zum Gelingen des Lehrgesprächs beiträgt, ist die Fragetechnik der ausbildenden Person. Nicht nur in der Ausbildereignungsprüfung wird hier oft der Fehler gemacht, entweder überwiegend geschlossene Fragen zu stellen oder Auszubildende lediglich zu Fragen: „Was fällt dir zu dem Thema ein?“. Genau diese Frage verleitet im nächsten Schritt dazu, dass Sie die Inhalte erklären, wenn Auszubildende keine Antwort parat haben.
Wissen Auszubildende einmal nicht weiter, sollten Sie nicht selbst die zuvor gestellten Fragen beantworten. Helfen Sie den Auszubildenden vielmehr auf die richtige Spur, indem Sie Ihre Fragen umformulieren oder Alternativfragen stellen.
Wenn Sie nach dem „Warum“ einer Handlung fragen, sind die daraus gewonnenen Erkenntnisse besonders wichtig für Auszubildende, weil sie so die Hintergründe der Handlungen verstehen können.
Ein weiterer Fehler beim Einsatz des Lehrgesprächs in der Ausbildereignungsprüfung ist, dass Ausbilder:innen zwar die Inhalte mit den Auszubildenden erarbeiten, diese Inhalte jedoch dann ohne Abschluss der Ausbildungseinheit stehen lassen. Ein Lehrgespräch schließt mit der Zusammenfassung der Inhalte durch Auszubildene ab. Die Auszubildenden fassen zum Abschluss der Ausbildungseinheit in eigenen Worten noch einmal zusammen, was zuvor erarbeitet wurde.
Zum Lehrgespräch, gehört ebenfalls eine Lernerfolgskontrolle. Sie stellen somit sicher, dass Auszubildende die Lerninhalte tatsächlich verstanden haben.
Vorkenntnisse zum Thema müssen vorhanden sein
Als Grundvoraussetzung für ein Lehrgespräch, müssen Auszubildende ein bestimmtes Maß an Vorkenntnissen zum relevanten Thema mitbringen. In der Ausbildereignungsprüfung sollten Sie die Vorkenntnisse besonders beachten, wenn bei einer praktischen Durchführung die „Auszubildenden“ von der prüfenden Stelle zugewiesen werden.
Sollten Auszubildende für die geplante Ausbildungseinheit keine Vorkenntnisse aus dem beruflichen Bereich mitbringen, können Sie alternativ an bereits vorhandene Vorkenntnisse aus dem Privatleben anknüpfen. Je mehr Sie Anknüpfungspunkte aus dem Alltag finden, umso besser können Sie im Lehrgespräch mit entsprechenden Fragen und Impulsen arbeiten.
Achter Fehler in der Ausbildereignungsprüfung: Sie wenden die Methodenkompetenz der Auszubildenden falsch an.
Die berufliche Handlungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse von Auszubildenden, die sie befähigen, die berufliche Tätigkeit selbstständig zu planen, durchzuführen und zu kontrollieren.
Es gibt es vier Teilbereiche, die gemeinsam die berufliche Handlungsfähigkeit definieren:
- Fachkompetenz
- Methodenkompetenz
- Sozialkompetenz
- Individualkompetenz
Ein verbreiteter Fehler in der Ausbildereignungsprüfung ist es, dass die Methodenkompetenz oftmals von den Teilnehmenden der Prüfung nicht richtig angewendet wird. Für die korrekte Anwendung der Methodenkompetenz ist es zunächst wichtig, zwischen der Methodenkompetenz ausbildender Personen und der Methodenkompetenz Auszubildender zu unterscheiden.
Die Methodenkompetenz von Ausbilder:innen ist es, für die jeweiligen Ausbildungssituationen die richtige Ausbildungsmethode zu wählen. Die Kriterien für die Auswahl einer Ausbildungsmethode sind unter anderem der Kenntnisstand der Auszubildenden, die zur Verfügung stehende Zeit, die Vorkenntnisse der Auszubildenden und der betroffene Lernbereich. Genau diese Methodenkompetenz sollen Sie auch bei der Ausbildereignungsprüfung unter Beweis stellen.
Die Methodenkompetenz von Auszubildenden hingegen, ist die Erarbeitung einer neuen Vorgehensweise, das Lösen von Problemen und der Transfer der Lerninhalte auf andere Themengebiete. Die Methodenkompetenz von Auszubildenden bedeutet eindeutig nicht, dass Auszubildende die einzelnen Schritte der Ausbildungseinheit nachvollziehen kann. Es heißt auch nicht, dass sie wissen welche Ausbildungsmethode gerade eingesetzt wird. Wenn Sie beispielsweise Auszubildenden im Ausbildungsberuf „Restaurantfachmann/frau“ mit der Vier-Stufen-Methode beibringen, wie Servietten in Form einer „Bischofsmütze“ richtig gefaltet werden, so ist das aus der Perspektive der Auszubildenden keine Methodenkompetenz. Vielmehr kennen die Auszubildenden die einzelnen Arbeitsschritte und wissen was zu tun ist, um das gewünschte Endergebnis zu erreichen. Somit fällt dieses Wissen für Auszubildende in den Bereich der Fachkompetenz.
Neunter Fehler in der Ausbildereignungsprüfung: die Vier-Stufen-Methode ist die einzige Ausbildungsmethode für die AEVO Prüfung
Die Vier-Stufen-Methode ist die wohl bekannteste Ausbildungsmethode und wird in der praktischen Ausbildereignungsprüfung oft eingesetzt.
Bekanntermaßen besteht die Vier-Stufen-Methode aus:
- Stufe 1 – vorbereiten
- Stufe 2 – vormachen und erklären
- Stufe 3 – nachmachen und erklären lassen
- Stufe 4 – üben
1. Stufe – vorbereiten
Eine Ausbildungseinheit will gut vorbereitet sein. Ausbilderinnen und Ausbilder legen im Vorfeld das Lernziel, den Inhalt, den Umfang, die Gliederung und die benötigte Zeit der Ausbildungseinheit fest. Bei der Planung sind geltende Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften, sowie Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten. Die für die Ausbildungseinheit benötigten Arbeitsmittel werden ebenfalls von Ihnen bereitgelegt. Als Hilfsmittel verwenden Sie am besten die originalen Werkzeuge, Werkstoffe und Arbeitsmaterialien.
Wecken Sie bei den Auszubildenden zunächst das Interesse an dem, was gleich folgen soll und begeistern Sie sie für die bevorstehende Aufgabe. Erklären Sie in groben Zügen, was gleich auf die Auszubildenden zukommt, damit sie sich sicherer fühlen. Sie können dann mit einer kurzen Wiederholung von bereits Bekanntem starten, feststellen was noch im Gedächtnis geblieben ist und dann zu Neuem überleiten indem Sie an Vorerfahrungen anknüpfen.
Auszubildende hören in dieser Stufe den Ausführungen der ausbildenden Person zu und beantwortet die an gestellten Fragen. (Dauer ca. 3 Minuten)
2. Stufe – vormachen und erklären
In dieser Stufe führen Sie Ausbilderinnen und Ausbilder den Vorgang schrittweise vor. Sie erklären und begründen, was getan werden muss, wie es getan werden muss und warum das so ist. Sie ergänzen Hinweise und Erklärungen, wie sich die Lernenden verhalten sollen.
Fordern Sie die Auszubildenden dazu auf, genau zu beobachten und zuzuhören. Geben den Azubis die Möglichkeit nachzufragen. Sie können den Auszubildenden bereits in dieser Stufe Material oder Ausbildungsmittel in die Hand geben, damit sie dieses begutachten und sich damit vertraut machen können.
Sorgen Sie als Ausbilder:in ebenfalls dafür, dass Auszubildende Ihre Handgriffe gut sehen können.
Denken Sie daran, dass Auszubildende später alles nachmachen sollen, was Sie vorher vorgemacht haben. Achten Sie daher auf eine korrekte Ausführung der Arbeitsschritte. Schließlich möchten Sie nicht, dass sich Auszubildende fehlerhafte Handgriffe abschaut, oder? (Dauer der Stufe ca. 4 Minuten)
3. Stufe – nachmachen und erklären lassen
Fordern Sie nun, nachdem Sie geendet haben, die Auszubildenden dazu auf, den Arbeitsschritt selbst nachzumachen und dabei zu den einzelnen Vorgängen entsprechende Klärungen abzugeben. Sie beobachten die Handgriffe und hören den Erklärungen zu.
An den Handlungen und den Erklärungen, können Sie erkennen, ob das „was“, „wie“ und „warum“ von den Auszubildenden verstanden wurde. Sie loben bei einer korrekten Ausführung der Arbeitsschritte, greifen bei Gefahr ein und korrigieren Fehlverhalten oder stellen Kontrollfragen.
Fehler in den Handgriffen sollten sofort korrigiert werden. Schließlich sollen Auszubildende die einzelnen Arbeitsschritte und die korrekte Anwendung von Anfang an richtig ausführen. Je nach Bedarf kann das mehrmals wiederholt werden. Trotzdem ist in dieser Stufe der Vier-Stufen-Methode die Rolle ausbildender Personen weitgehend passiv. (Dauer der Stufe ca. 4 Minuten)
4. Stufe – selbstständig üben lassen und Abschluss
Stellen Sie den Auszubildenden nun Übungsaufgaben, damit sich das Gelernte festigt. Die Auszubildenden arbeiten nun selbstständig an der Aufgabenstellung weiter, indem die Übungsaufgaben durchführt und das Ergebnis kontrolliert wird. Sie stehen weiterhin beratend zur Seite, falls Fragen auftreten. Sie kontrollieren und bewerten das Arbeitsergebnis und loben die Fortschritte. Weisen Sie abschließend auf die nächste Lerneinheit hin und erinnern Sie die Auszubildenden an die Eintragung in den Ausbildungsnachweis. (Dauer der Stufe ca. 4 Minuten)
Im Ausbildungsalltag und in der Ausbildereignungsprüfung, ist die Vier-Stufen-Methode noch immer noch eine der am häufigsten eingesetzten Ausbildungsmethoden. Die Gründe dafür sind vielfältig.
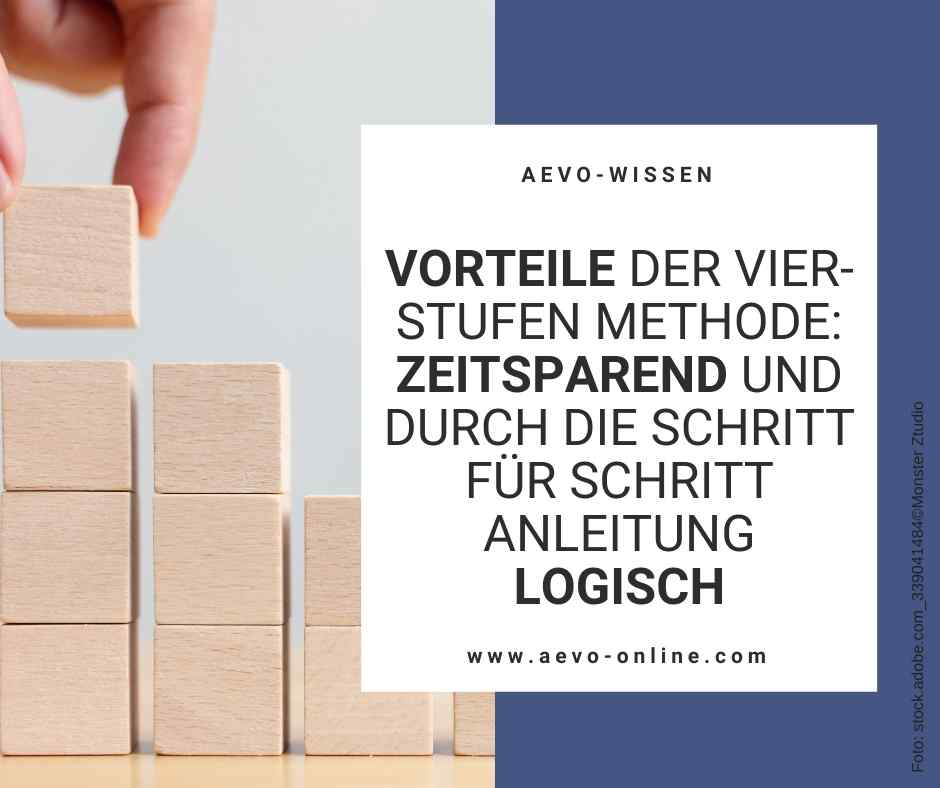 In der Vier-Stufen-Methode ist ganz klar vorgegeben, welche Arbeitsschritte nacheinander zu befolgen sind. Das macht die Vier-Stufen-Methode für Ausbilderinnen und Ausbilder sehr bequem. Die Vier-Stufen-Methode ist jedoch nicht für jedes Thema geeignet. Wenn das Thema und die Aufgabenstellung jedoch zur Vier-Stufen-Methode passen, ist sie für die Ausbildereignungsprüfung eine geeignete Methode, die Ihnen Sicherheit bietet und wenig Überraschungen bringen sollte.
In der Vier-Stufen-Methode ist ganz klar vorgegeben, welche Arbeitsschritte nacheinander zu befolgen sind. Das macht die Vier-Stufen-Methode für Ausbilderinnen und Ausbilder sehr bequem. Die Vier-Stufen-Methode ist jedoch nicht für jedes Thema geeignet. Wenn das Thema und die Aufgabenstellung jedoch zur Vier-Stufen-Methode passen, ist sie für die Ausbildereignungsprüfung eine geeignete Methode, die Ihnen Sicherheit bietet und wenig Überraschungen bringen sollte.
Mit der Vier-Stufen-Methode vermitteln Sie keine keine berufliche Handlungskompetenz
Mit der Vier-Stufen-Methode erreichen Sie bei Auszubildenden jedoch keine berufliche Handlungskompetenz. Von der Kultusministerkonferenz wird die berufliche Handlungskompetenz definiert als „die Bereitschaft und Befähigung des Einzelnen, sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachgerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten“.
Die berufliche Handlungskompetenz setzt sich somit zusammen aus
- Fachkompetenz (Fachliche Fähigkeiten einsetzen)
- Methodenkompetenz (Arbeitsabläufe problemadäquat zu gestalten)
- Sozialkompetenz (sich mit anderen Personen situationsadäquat auseinandersetzen)
- Persönlichkeitskompetenz (innere Einstellung und Fähigkeit zu Bewältigung beruflicher Situationen)
Während die anderen Kompetenzbereiche bei der Vier-Stufen-Methode mehr oder weniger ausgeprägt abgedeckt sind, kommt die Vermittlung der Methodenkompetenz eindeutig zu kurz. Den Begriff der „beruflichen Handlungsfähigkeit“ sollten Sie im Fachgespräch der praktischen Ausbildereignungsprüfung kennen und erklären können.
Sie können folglich mit der Vier-Stufen-Methode das selbstständige Planen, Durchführen und Kontrollieren der Arbeitsschritte durch Auszubildenden nicht abbilden. Um die berufliche Handlungskompetenz zu erlangen, sind andere Ausbildungsmethoden besser geeignet als die Vier-Stufen-Methode.
Ebenso können Sie mit der Vier-Stufen-Methode nicht jedem Lernziel gerecht werden. Wenn kognitive Themen in der Vier-Stufen-Methode vermittelt werden, führt dies oft zu einer Überforderung der Auszubildenden, da sie sich oft nicht alle Inhalte auf einmal merken können.
Sehr gut geeignet ist die Vier-Stufen-Methode hingegen zur Vermittlung, sowie dem Üben und dem Ausbau, von psychomotorischen oder gewerblichen Fertigkeiten – also immer, wenn „praktisch“ etwas gelernt werden soll.
Die Vier-Stufen-Methode ist also eine Ausbildungsmethode aber nicht die einzige Ausbildungsmethode. Das gilt sowohl für die Ausbildereignungsprüfung als auch für die Praxis.








8 Kommentare. Hinterlasse eine Antwort
Hallo,
ich stehe kurz vor meiner praktischen Prüfung,
mein Thema ist: Wareneingangskontrolle.
Mein Feinlernziel ist:
Der Auszubildende kann nach der Unterweisung selbständig Lieferungen im Bereich des Wareneingangs annehmen, auspacken, die Ware auf offene und versteckte Mängel überprüfen und mit dem beiliegenden Lieferschein abgleichen.
Mir wurde gesagt, es ist hierbei sinnvoller das Lehrgespräch anzuwenden.
Habt ihr paar Tipps, warum das Lehrgespräch hier sinnvoller ist ?
Mit freundlichen Grüßen
Mark
Hallo Mark,
die Methode muss zum Lernzielbereich passen. Der kognitive Lernzielbereich beschreibt, was Auszubildende wissen, erkennen und begreifen sollten (Kenntnisse). Das Lehrgespräch kann also durchaus geeignet sein und passend umgesetzt werden.
Viel Erfolg für die Prüfung!
Ihr Team von AEVO Online
Hallo,
ich habe bald meine praktische Ausbildereignungsprüfung und bin mir gerade unschlüssig, was das Thema Lernerfolgskontrolle angeht. Als Methode habe ich mich für das Lehrgespräch entschieden. Wann genau muss ich dabei die Lernerfolgskontrolle erwähnen?
Muss ich erst die 3 Stufen des Lehrgesprächs erläutern und anschließend die Lernerfolgskontrolle erklären oder muss ich die Lernerfolgskontrolle zwischen Stufe 2 und 3 des Lehrgesprächs schieben?
Über eine schnelle Rückantwort würde ich mich sehr freuen!
Danke und liebe Grüße, Sarah.
Hallo liebe Sarah,
wirf einmal einen Blick in diesen Beitrag ▶️ „Anleitung: Lernerfolgskontrollen durchführen“.
Darin wird das wichtigste zur Lernerfolgskontrolle in der AEVO-Prüfung erklärt.
Grundsätzlich kann das Üben erst erfolgen, wenn zuvor eine Kontrolle stattgefunden hat.
Viel Erfolg für die Prüfung und viele Grüße vom
Team von AEVO Online
Hallo,
ich verzweifle, da ich die 4 Stufen Methode für Sinnvoll erachte, dennoch an der Wahl. Ich möchte Grundlagen in der Programmierung erläutern durch Vormachen & Nachmachen aber es ist nichts psychomorisches, die anderen Methoden passen jedoch nicht. Ist die 4 Stufen Methode hier dennoch angebracht?
Liebe Grüße
Hallo,

nun wenn es „nichts psychomorisches“ ist, dann passt die Vier-Stufen-Methode nicht. Für kognitive Lernziele, also Wissen und die Anwendung für wissen, gibt es andere, geeignetere Methoden. ????
Daher die Empfehlung: Werfen Sie nochmals einen Blick in Ihre Unterlagen oder wenden Sie sich für detaillierte Unterstützung an den Trainer/die Trainerin Ihres Vorbereitungskurses.
Viel Erfolg bei Ihrer Prüfung.
Ihr Team von AEVO Online
Hallo,
bei der vier-Stufen Methode komme ich in Ihrem Artikel auf insgesamt 15 Minuten Zeit. Uns wurde im Lehrgang gesagt, dass wir maximal 12 Minuten zur Verfügung haben. Jetzt frage ich mich, was man auslassen, verkürzen oder verlagern könnte. Ist es z.B. möglich, die Übungsphase aus der Prüfung auszuklammern, sozusagen: „ok, nun würde ich dich bitten, diese Übung noch einmal am Arbeitsplatz auszuführen…“ so dass man die Übungsphase nicht noch in der Prüfungszeit durchführen muss.
Viele Grüße
Hallo,
wie lange der praktische Prüfungsteil dauern darf, regelt § 4 (3) AEVO. Daher kommen Sie auf die 15 Minuten bei uns im Betrag. Ein Maximum von 12 Minuten ist also rechtlich betrachtet nicht zulässig.
Um Ihre Frage zu beantworten: Ja, es ist möglich die Übungsphase nachzulagern. Wenn beispielsweise Auszubildende zur Übung noch weitere 20 Werkstücke bearbeiten sollen, wäre das in 15 Minuten gar nicht abzubilden. Was jedoch zwingend vor der Übung sein muss, ist die Lernerfolgskontrolle.
Viele Grüße und viel Erfolg für Ihre Prüfung
Ihr Team von AEVO Online